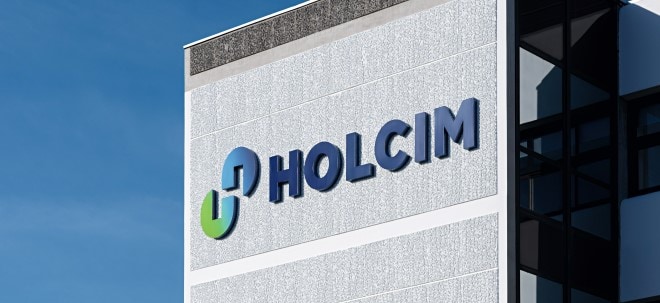Risikoforscher Beck: Die Brutalität des Scheiterns bedroht auch Deutschland
Der Soziologe Ulrich Beck ist einer der bedeutendsten Risikoforscher der Welt. Ein Gespräch über die Eurokrise, ignorante Ökonomen und kaschiertes Nichtwissen.
Das Interview führte €uro-Redakteur Mario Müller-Dofel.
€uro: Herr Beck, Sie sind Soziologe. Warum lassen Sie sich von einem Wirtschaftsmagazin zur Eurokrise befragen?
Ulrich Beck: Lassen Sie mich mit einer Anekdote antworten: An der London School of Economics, wo ich lehre, wurde 2009 ein neues Gebäude eingeweiht. Hauptrednerin war Königin Elisabeth und sie fragte: Liebe Ökonomen, warum haben Sie uns nicht die Krise vorausgesagt, die jetzt über uns hereingebrochen ist? Das hat in Großbritannien hitzige Diskussionen ausgelöst. Ich sage: Die Wirtschaftswissenschaften haben versagt — und es ist höchste Zeit, die Pluralität der sozialwissenschaftlichen Stimmen zur Krise in Europa öffentlich zur Sprache zu bringen.
Weiß die Soziologie denn mehr als die Ökonomie?
Beck: Die eine Soziologie gibt es nicht. Aber Soziologen haben andere Sichtweisen. Für mich hängt die Krise eng mit der Kombination aus Risiko und Gesellschaft zusammen. Mit der Risikogesellschaft, wie ich sie nenne.
Was verstehen Sie unter „Risiko“?
Beck: In der globalisierten Welt ist Risiko faszinierend, außerordentlich beweglich und unberechenbar. Es ist die Antizipation einer Zukunft, über die wir nichts wissen können, die aber angeblich über Risikoberechnungen kontrollierbar gemacht werden kann.
Was charakterisiert Ihrer Ansicht nach unsere Risikogesellschaft?
Beck: Vor allem dieses Nichtwissen und seine Folgen, deren Ausmaß wir nicht erkennen können. Uns fehlt ein Instrumentarium, das die Riskanz bestimmter Entscheidungen transparent macht. Denn ihre Folgen können extrem gefährlich für ganze Gesellschaften werden.
Sie sind ein Pessimist, oder?
Beck: Im Gegenteil. Die Gefahren, die uns die Finanz- und Schuldenkrise gebracht hat, haben eine enorme Mobilisierungskraft und zwingen Institutionen zu neuen Antworten darauf, wie die durch die Krise offenbarten Schwächen unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems beseitigt werden können. Das ist natürlich ein Realexperiment, bei dem die Teilnehmer auch viel spekulieren.
Politiker und Ökonomen vermitteln uns aber, dass sie die Krise im Griff haben.
Beck:Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Zumal das Nichtwissen in der Geschichte der Ökonomie, aber auch in der jüngeren Soziologie, immer wieder ein großes Thema war. Es ist übrigens kein Geringerer als der berühmte Ökonom John Maynard Keynes
gewesen, der 1937 in einer seiner großen Schriften darauf hinwies, dass Wahrscheinlichkeitsrechnungen für bestimmte Entscheidungen untauglich sind, weil sie das Nichtwissen kaschieren. Aber das ignoriert die Ökonomie weitgehend.
Und die Soziologen?
Beck: Wir halten es mit Keynes — und stellen die Unschärfe zwischen Riskanz und Nichtwissen ins Zentrum.
Warum tun sich damit Wirtschaftswissenschaftler und Politiker so schwer?
Beck: Weil das mit dem zentralen Anspruch von Staaten kollidiert, den Bürgern Sicherheit zu vermitteln. Da wird Nichtwissen überspielt, indem man Sicherheit und Kontrollierbarkeit behauptet. Das ist ein Grund dafür, warum die Politik ständig ihre Ziele revidieren muss, wenn offensichtlich wird, dass sie unrealistisch sind. Schauen Sie sich nur die Entwicklung in der Eurozone an.
Warum gibt es hierzulande die „Wirtschaftsweisen“ als Regierungsberater, aber keinen „Rat der Soziologen“?
Beck: Eine wunderschöne Frage. Aber die Antwort ist weniger schön. Die Sozialwissenschaften haben an Einfluss verloren. Zu Unrecht, finde ich.
Aus welchem Grund?
Beck: Unter Soziologen gibt es weit mehr Denkrichtungen als unter Ökonomen, also weniger Konsens. Soziologen liefern auch keine fertigen Antworten, sondern ermöglichen Reflexionen, die den Grad der Verunsicherung und ihre Folgen in der Gesellschaft wiedergeben. Und wenn Soziologen etwas empfehlen, versuchen sie, sich nicht zu überschätzen und keine falschen Gewissheiten vorzugaukeln. Mir scheint, dass die Politik und die Öffentlichkeit aber einfach klingende und unreflektierte Lösungen bevorzugen.
Wie lassen sich allzu riskante Entscheidungen in der Eurokrise vermeiden?
Beck: Zum Beispiel durch öffentliche Diskurse um Entscheidungen. Solche kommen durch die fortschreitende öffentliche Wahrnehmung der Risiken gerade in Gang.
Studien zufolge versteht ein Großteil der Deutschen ökonomische Zusammenhänge nur unzureichend. Was soll es bringen, wenn solche Laien mögliche Krisenlösungen mitdiskutieren?
Beck: Engagement für Themen, die sie vorher weitgehend Politikern und Bankern überlassen haben. Das ist positiv! Plötzlich muss ein Bankchef seine Entscheidungen
öffentlich rechtfertigen. So entwickelt sich mehr Bewusstsein für Nichtwissen und Entscheidungsmängel sowie ein gesunder Vertrauensverlust gegenüber der Politik und Wirtschaftsexperten, die ihre Entscheidungen auf angeblich sicheres Wissen stützen.
Wer ist verantwortlich für die Staatsschuldenkrise? Zumeist werden Banker, Ökonomen, Politiker oder das System genannt.
Beck: Wir haben es mit einer Art organisierter Unverantwortlichkeit zu tun. Das gilt übrigens auch für den Raubbau an der Natur. Niemand will verantwortlich sein. Unser System ist ein Schwarzer-Peter-Spiel, in dem sich Verantwortung kaum zuordnen lässt, sondern ständig umverteilt wird. Dabei ist die Haftungsfrage ein Schlüssel im Umgang mit Risiken.
Wie kann der normale Bürger gesellschaftsrelevante Risiken erkennen?
Beck: Wenn es für bestimmte Risiken kein privates Versicherungssystem gibt, das im Katastrophenfall einspringt, scheint das Risiko unkalkulierbar zu sein. Für Bankencrashs — wie auch für Atomkraftwerksschäden — gibt es so etwas nicht. Stattdessen wird die Versicherung auf die Gesellschaft abgewälzt. Allerdings ist die private Versicherung eine funktionierende Art der Selbstregulierung. Was für den Autoverkehr gilt, sollte auch für den Finanzverkehr gelten: Wer ohne privaten Versicherungsschutz über alle Grenzen hinweg Finanztransaktionsgeschäfte tätigt, handelt kriminell. Ich verstehe nicht, warum die Branche das nicht selbst thematisiert.
Folgender Satz stammt von Ihnen: „Der Staat gilt als Schöpfer, Kontrolleur und Garant der Gesellschaft.“ Trifft das in der Europäischen Union heute noch zu?
Beck: Das gilt nach wie vor. Aber tatsächlich haben Staaten, auch der deutsche, durch die Mobilität des Kapitals fundamental Macht und Kontrolle verloren. Denn Politik wird von den Bürgern auf Dauer nur akzeptiert, wenn sie zu Hause Arbeitsplätze schafft. Doch heute schaffen viele deutsche Konzerne mehr Arbeitsplätze im Ausland als im Inland. Die Voraussetzungen dafür hat die neoliberale Reformpolitik geschaffen. Der deutsche Nationalstaat hat sich selbst kastriert.
Was bedeutet die Entmachtung für Deutschland?
Beck: Als Einzelstaat ist Deutschland inzwischen relativ hilflos. Aber wir sind ja kein Einzelstaat mehr, sondern Teil der vernetzten EU. Und in Europa wird Deutschland nicht entmachtet, sondern ermächtigt, eine tragende Rolle zu spielen. Das stärkt uns. Schauen Sie nur, welche Bedeutung Kanzlerin Angela Merkel weltweit hat. Fiele die EU infolge der Eurokrise auseinander, verlöre Deutschland erheblich an Einfluss.
Wer ist mächtiger: ein Siemens-Chef, ein Deutsche-Bank-Boss oder Frau Merkel?
Beck: Der Einfluss der Manager übersteigt oft die Macht einzelner Politiker. Denn ihre eigenständigen Entscheidungsmöglichkeiten sind größer: Manager haben keine parlamentarische Verantwortung, müssen keine Parteipolitik beachten und können mit Arbeitsplatzverlagerungen drohen. Gleichzeitig gewinnt die europäische Politik an Einfluss. Denn die Entscheidungen, die Repräsentanten wie Angela Merkel im Zuge der Schuldenkrise fällen, werden große Auswirkungen auf Europa haben. Manager und Politiker haben schwer vergleichbare Machtpotenziale. Die Welt ist sehr kompliziert geworden.
Frau Merkel predigt, dass die Eurorettung „alternativlos“ sei. Wie sehen Sie das?
Beck: Genau so. Europa ist wie ein Rührei. Wer das Weiße vom Gelben trennen will, dürfte scheitern. Es ist bedauerlich, dass wir immer noch in nationalstaatlichen Kategorien denken, obwohl es Deutschland so nicht mehr gibt. Ich meine auch, dass die EU und der Euro ein Wunder ermöglicht haben, denn dadurch sind Feinde zu Partnern geworden. Ob das ohne eine Gemeinschaftswährung so bliebe, ist eine offene Frage.
Die Demokratie in Deutschland sei im Zuge der Schulden- und Währungskrise in Gefahr geraten, warnt sogar Ex-Bundespräsident Roman Herzog. Übertreibt er?
Beck: Nein, das trifft sogar auf die gesamte EU zu, weil die politische und soziale Architektur unserer Demokratien auf nationalstaatliche Entscheidungsprozesse ausgerichtet ist. Tatsächlich aber werden die Prozesse längst von Institutionen wie der EU-Kommission, dem Internationalen Währungsfonds und globalen Konzernen bestimmt. Dieses Problem ist aber nicht ad hoc lösbar.
Ist es überhaupt lösbar?
Beck: Dafür brauchen wir das Prinzip der Zurechenbarkeit und der gläsernen Institutionen — Transparenz für die Öffentlichkeit.
Wie könnte das funktionieren?
Beck: Zum Beispiel, indem wir Kontrolleure in Entscheidungsgremien entsenden, die echte Transparenz herstellen. Bislang ist Europa ein Eliteprojekt, das die Bürger nicht mehr nachvollziehen können. Das gilt auch für das Krisenmanagement. Es fördert Verteilungskämpfe und neues Nationalbewusstsein, das die historische Idee eines vereinten Europas zu verraten droht.
Wie kann die europäische Idee wieder populärer werden?
Beck: Wir sollten sie jetzt von unten neu begründen. Anfangen könnte man mit einem freiwilligen europäischen Jahr, in dem unter anderem Hunderttausende Jugendliche in ein anderes Land gehen, um dessen Sprache zu lernen, dessen Gesellschaft kennenzulernen, und um gemeinsam an europäischen Projekten zu arbeiten. So entstünde eine Generation, die Europa aktiv und kritisch mitgestaltet.
Und wer soll das bezahlen?
Beck: Die Staaten und die Wirtschaft natürlich. Angesichts der Eurokrise gibt es nichts Wichtigeres.
Es gibt zurzeit viele Untergangspropheten. Diese scheinen realistischer als Europa-Optimisten wie Sie zu sein.
Beck: Die Berufspessimisten machen es sich intellektuell sehr leicht. Andererseits ist die Antizipation von Katastrophen sinnvoll, weil nur dadurch Katastrophen verhindert werden können. Die herausfordernde Aufgabe ist es aber, trotz der Zusammenbrüche von Gewissheiten — wie der, dass Schuldenmachen ungefährlich sei — positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Meine Devise heißt hier „kooperieren oder scheitern“: Je mehr uns das Scheitern droht, desto intensiver müssen wir versuchen, neue Kooperationen in Gang zu setzen.
Klingt gut, aber funktioniert das?
Beck: Denken Sie nur an die lange tabuisierten Begriffe „europäische Wirtschaftsregierung“ und „Fiskalunion“ — die machen deutlich, dass angesichts der Brutalität des Scheiterns ein neues Miteinander entsteht.
Wie legen Sie Ihr Geld an?
Beck: Ein Professor hat ja nicht viel Geld. Aber das bisschen, das ich habe, investiere ich möglichst sicher in Immobilien. Wie gesagt: Den ökonomischen Risikoberechnungen traue ich nicht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vita
Ulrich Beck, geboren am 15. Mai 1944 in Stolp/Hinterpommern, studierte Soziologie, Philosophie, Psychologie und Politik in München, wo er bis 2009 an der Ludwig-Maximilians-Universität lehrte. 1979 wurde er in Soziologie habilitiert. Sein Hauptinteresse gilt dem Wandel moderner Gesellschaften in der Globalisierung. Seine Bücher „Risikogesellschaft“ (1986) und „Weltrisikogesellschaft“ (2007) wurden Bestseller. Heute lehrt der weltweit beachtete Wissenschaftler an der London School of Economics and Political Science