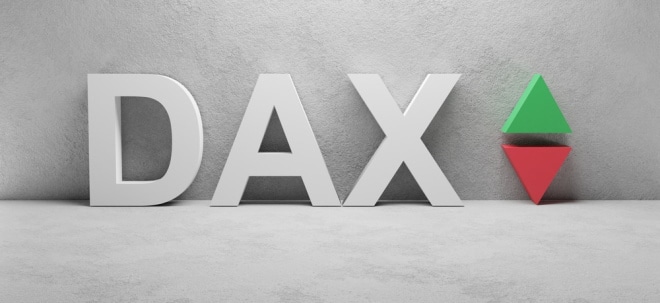Seitwärtsbewegung nach Zwischenerholung

Die Notenbanken, namentlich Ben Bernanke, Chef der amerikanischen Fed, schickten die Märkte zu Beginn des Sommers auf Talfahrt und sie verhalfen ihnen auch wieder auf die Beine.
von Dr. Ekkehard J. Wiek, Vermögensverwalter und Asien-Fondsmanager, W&M Wealth Managers (Asia) Pte Ltd. in Singapur
Als die Fed den Einstieg in den Ausstieg aus dem Anleiheaufkaufprogramm öffentlich thematisierte und sogar einen möglichen Zeitrahmen skizzierte, war es zunächst vorbei mit den Kursgewinnen in den USA, Europa, aber auch in weiten Teilen Asiens. Anfang Juli bekräftigte Bernanke dann jedoch die Notwendigkeit dauerhaft niedriger Zinsen in den USA ebenso, wie die Fortführung des Anleiheaufkaufprogramms in einem Volumen von 85 Mrd. US-Dollar pro Monat.
Auch die EZB stieß in das gleiche Horn und verließ dabei sogar die jahrelang geübte Praxis, sich niemals längerfristig festzulegen. Stattdessen bestätigten die Notenbanker die Politik historisch niedriger Zinsen noch „für eine geraume Zeit“ aufrecht zu erhalten. Die Mission dieser Forward Guidance, der Lenkung der Erwartungen, war es, Zeit zu kaufen und die wirtschaftlichen Erholungsprozesse nicht zusätzlich zu gefährden. Der Coup gelang, und wie befreit zogen die Notierungen an den Weltbörsen vorübergehend wieder an. Doch nun scheinen sich die positiven Notenbankeffekte abzuschwächen. Auch in Asien befindet sich der breite Markt in einer abwartenden Seitwärtsbewegung.
Mehr Fragen als Antworten in China
Es scheint, als suchten die Börsen nach neuer Orientierung. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal konnte bisher keine richtungsweisende Funktion übernehmen, dazu waren die Unternehmensnachrichten aus den verschiedenen Branchen zu unterschiedlich. Es sind vielmehr die großen volkswirtschaftlichen Fragestellungen, die die Investoren bewegen. In Asien betreffen diese vor allem die Umstellungen auf den beiden größten Märkten China und Japan.
Dass in China die Zeiten des ungebremsten Wachstums vorbei sind, damit hatten sich die Märkte bereits abgefunden. Dass aber der chinesische Finanzminister die eigene Zielsetzung vom Anfang des Jahres (7,5 Prozent BIP-Wachstum) infrage stellen und ein Wachstum von sieben Prozent prognostizieren würde, war neu. Das statistische Amt in Peking meldete tags darauf denn auch prompt ein zielkonformes Wachstum von 7,5 Prozent für das zweite Quartal und bekräftigte den Wert für das Gesamtjahr. Die Episode zeigt, wie unsicher selbst die Parteikader im China über den Ausgang des wirtschaftlichen Umgestaltungsprozesses sind. Das Land steht vor einer Herkulesaufgabe: Einerseits gilt es, Blasenbildungen durch ein zu ungestümes Wachstum vorzubeugen, andererseits ist eine Lösung von der Exportfixierung durch Stärkung der Binnennachfrage, ohne hinreichendes Wachstum nicht zu bewältigen. Wie hoch dieses Wachstum sein muss und welche Probleme vor allem im Finanz- und Bankensektor bisher aufgelaufen sind − diese Fragen werden die Investoren auf Dauer beschäftigen.
Gestiegene Volatilität in Japan
In Japan ist die Strategie des billigen Geldes und einer eher inflationären Politik durch den Wahlerfolg von Shinzo Abe und seiner LDP-Partei bestätigt worden. Die Strategie, mit einer gezielten Schwächung des Yen und mit gewaltigen Konjunkturprogrammen die heimische Wirtschaft zu stützen, dürfte also weiter verfolgt werden. Doch die Anhänger der „Abenomics“ mussten bereits lernen, dass nach anfänglichen Erfolgen auch Rückschläge kommen können. Entgegen den Bemühungen der Notenbank stieg der Kurs des Yen in den vergangenen sechs Wochen wieder an. Und so, wie Japans wichtige Export-Industrie zuvor vom schwachen Yen profitiert hatte, macht sich der Aufwärtstrend der Währung jetzt negativ in den Bilanzen bemerkbar. Am Mittwoch brach der Nikkei um 4% ein. Auf Jahressicht ist die relative Stärke des japanischen Marktes dennoch beachtlich. Weit über 30 Prozent liegt der Nikkei immer noch im Plus. Ob dies ein von der Geldpolitik initiiertes Strohfeuer bleiben wird, oder ob Regierung und Notenbank wirklich den notwendigen strukturellen Umbau der Wirtschaft vorantreiben können – auch hier sind kurzfristig keine befriedigenden Antworten zu erwarten.
Stockpicking weiter empfehlenswert
Mit Ausnahme Japans sind die Börsen des asiatisch-pazifischen Raumes im bisherigen Jahresverlauf hinter den Entwicklungen der großen westlichen Märkte zurückgeblieben. Vergleichsweise stark präsentieren sich nach wie vor Malaysia, Indonesien und Taiwan, auch der australische Markt hält sich unter hohen Schwankungen auf Jahressicht noch im Plus. Die bereits erwartete Zinssenkung vom Dienstag brachte jedoch nicht die erhoffte Belebung.
Statt auf ganze Märkte zu setzen empfiehlt sich in Asia-Pacific daher weiterhin eine gezielte Auswahl von fundamental günstig bewerteten Titeln.
Immer mehr Privatanleger in Deutschland vertrauen bei ihrer Geldanlage auf bankenunabhängige Vermögensverwalter. Frei von Produkt- und Verkaufsinteressen können sie ihre Mandanten bestmöglich beraten. Mehr Informationen finden Sie unter www.vermoegensprofis.de.
Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.